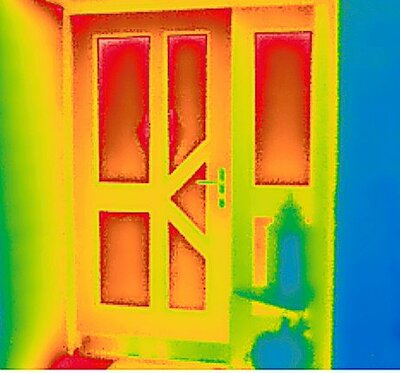Wärmepumpen sind bei Neubauten seit einigen Jahren das Standard-Heizsystem und kommen auch immer häufiger zum Einsatz, wenn eine Öl-, Gas- oder Elektrodirektheizung ersetzt wird. Die Popularität ist nachvollziehbar: Wärmepumpen sind klimaschonend und aus wirtschaftlicher Sicht mehr als nur konkurrenzfähig. Zudem lassen sie sich an fast allen Standorten realisieren, weil sie mit der Luft, dem Erdreich sowie Gewässern verschiedene Energiequellen nutzen können. Doch auch ein etabliertes System wie die Wärmepumpe entwickelt sich stetig weiter – so geht zum Beispiel der Trend hin zur Regeneration von Erdwärmesonden und zum Einsatz natürlicher Kältemittel.
Natürlich statt synthetisch
In Wärmepumpen und ähnlichen Geräten wie Kühlschränken und Klimageräten kommen herkömmlicherweise synthetische, also künstlich hergestellte, Kältemittel zum Einsatz (siehe Infobox). Sie sind zwar meist einfach einsetzbar und durchaus effizient, wirken sich jedoch bei einer Freisetzung – etwa infolge eines Lecks oder aufgrund einer unsachgemässen Entsorgung – negativ auf das Klima aus. Einige dieser Stoffe sind bis zu 2000-mal so klimaschädlich wie CO2 und tragen daher selbst in geringen Mengen stark zur Klimaerwärmung bei.
Akut ist die Gefahr allerdings nicht. Bestehende Wärmepumpen mit synthetischen Kältemitteln bleiben nach europäischen und Schweizer Normen technisch bewährte und zuverlässige Geräte. Sie dürfen grundsätzlich weiterbetrieben, gewartet und repariert werden, solange sie die Installationsvorschriften und Qualitätskontrollen einhalten. «Der Betrieb dieser Wärmepumpen ist unbedenklich: Sie funktionieren sicher und effizient», bestätigt Pierre Christe, Fachspezialist Wärme beim Bundesamt für Energie (BFE). «Herausfordernd ist vor allem die Entsorgung am Ende der Lebensdauer, weil dabei kein Kältemittel entweichen darf.»
Ab 2030 ist der Einsatz einiger besonders klimaschädlicher Kältemittel bei neuen Anlagen nicht mehr erlaubt, allerdings kommen diese bereits heute kaum mehr zum Einsatz. Zudem arbeiten die meisten Hersteller daran, ihre Wärmepumpen künftig mit natürlichen Kältemitteln auszuliefern. Diese sind deutlich weniger oder überhaupt nicht klimaschädigend. Christe geht davon aus, dass der Markt diese Umstellung regeln wird – eine weitere Regulierung ist deshalb nicht vorgesehen.
Ausgangslage berücksichtigen
Auf welches Kältemittel sollte man setzen, wenn man kurz- oder mittelfristig eine neue Wärmepumpe einbauen oder eine bestehende ersetzen will? Am besten trifft man diesen Entscheid gemeinsam mit einer Fachperson, weil dabei der Standort und die bauliche Ausgangslage einzubeziehen sind. Zu beachten ist, dass bei gewissen natürlichen Kältemitteln wie dem leicht entzündlichen Propan zusätzliche bauliche Sicherheitsmassnahmen erforderlich sind. «Viele Installateure haben inzwischen schon Erfahrung mit solchen Systemen sammeln können», erklärt Christe. «Sie wissen, worauf bei der Planung und Umsetzung zu achten ist und können bei Bedarf auf Weiterbildungsangebote der Branche zurückgreifen.»
Regeneration von Erdwärmesonden
Ein anderes aktuelles Thema im Zusammenhang mit Wärmepumpen betrifft die Erdwärmesonden. Sie machen die im Erdreich gespeicherte Wärme als Energiequelle für eine Wärmepumpe verfügbar. Doch je mehr Wärme dem Boden während der Heizperiode entzogen wird, desto eher droht langfristig eine Auskühlung des Erdreichs. Dies gilt vor allem für Gebiete, in denen eine hohe Nutzungsdichte von Erdwärmesonden realisiert ist. Kühlt das Erdreich zu stark aus, sinkt die Effizienz der Wärmepumpe: Wegen der abgesenkten Temperatur der Energiequelle benötigt sie mehr Strom.
Der Auskühlung lässt sich entgegenwirken, indem das Erdreich im Sommer passiv oder auch aktiv regeneriert wird. Das bedeutet, dass man warmes Wasser durch die Erdwärmesonden zirkulieren lässt, um das umgebende Erdreich wieder «aufzuladen». Die Wärme kann aus dem Gebäude selbst stammen, aus einer lokalen Solarthermieanlage oder aus Abwärme von gewerblichen oder industriellen Anlagen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Wärme über eine Wärmepumpe oder Heizstäbe mit überschüssigem Solarstrom erzeugen zu lassen. «Mit der Regeneration lässt sich der Wärmeentzug aus dem Winterhalbjahr ausgleichen», führt Christe aus. «Man kann so sicherstellen, dass die Wärmepumpe auch im nächsten Winter wieder effizient und mit tiefem Strombedarf arbeitet.»
Wirtschaftlichkeit prüfen
Weil für die thermische Regeneration gewisse technische Einrichtungen nötig sind, lohnt sie sich aus wirtschaftlicher Sicht nicht überall. Sinnvoll ist sie, wenn bereits eine Beeinflussung durch benachbarte Sonden feststellbar ist und dadurch die Effizienz der Wärmepumpe sinkt. In solchen Fällen rentiert sich die Investition auch bei Einfamilienhäusern. Bei grösseren Liegenschaften mit einer Wärmepumpenleistung ab 30 bis 40 Kilowatt kann sich eine Regeneration auch ohne drohende Auskühlung lohnen. «In diesem Fall nutzt man die Sonde im Sommer, um im Erdreich Wärme einzulagern», erläutert Christe. «Der Untergrund wird damit zu einem saisonalen Wärmespeicher.» Neben tieferen Betriebskosten lassen sich unter Umständen auch die Investitionskosten senken. So können manchmal bei Neubauten, die von Anfang an auf Regeneration setzen, weniger tiefe und damit günstigere Erdsonden realisiert werden.
Beratung einholen
Wer sich mit dem Heizungsersatz beschäftigt, kann sich im Rahmen einer Impulsberatung «erneuerbar heizen» (siehe Infobox oben) beispielsweise Fragen zu Anforderungen an eine zukünftige Wärmepumpe oder der Regeneration von Erdwärmesonden beantworten lassen. So ist es möglich, diese Anforderungen später bei einer Offertanfrage vorzugeben. Wer bereits eine Wärmepumpe in Betrieb hat und ein Upgrade prüfen möchte, wendet sich am besten an einen Heizungsplaner. So verschafft man sich rechtzeitig einen Überblick zu diesen wichtigen Themen und kann die weiteren Schritte ohne Zeitdruck planen.
Kältemittel
Das Kältemittel ist gewissermassen das «Blut» einer Wärmepumpe, denn es ermöglicht die Wärmeübertragung von der Energiequelle zum Gebäude. Es zirkuliert in einem Kreislauf und wird dabei immer wieder verdampft und kondensiert. Damit lässt sich die aus der Umwelt (Luft, Erdreich, Wasser) gewonnene Wärme auf das Temperaturniveau anheben, das für das Heizen oder Warmwasser benötigt wird.
Synthetische Kältemittel, die häufig aus der Gruppe der Fluor-Kohlenwasserstoffe (FKW) stammen, haben teilweise ein sehr hohes Treibhausgaspotenzial. Natürliche Kältemittel wie Propan, Ammoniak oder CO2 schneiden diesbezüglich wesentlich besser ab, erfordern aber teilweise zusätzliche technische Massnahmen, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
Weitere Informationen und Antworten bei Fragen zu Kältemitteln: fws.ch/kaeltemittel
Impulsberatung «erneuerbar heizen»
Lassen Sie sich jetzt kostenlos über die konkreten Möglichkeiten zum Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme beraten. Die Impulsberatung «erneuerbar heizen» ist ein Angebot des Bundes und steht insbesondere Eigentümerschaften von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Stockwerkeigentümerschaften kostenlos zur Verfügung.
Bei der Impulsberatung besichtigt eine Fachperson das Gebäude und gibt im persönlichen Gespräch einen Überblick, wie sich die bestehende Heizung durch ein erneuerbares Heizsystem ersetzen lässt. Auch eine grobe Kostenschätzung und Tipps zum weiteren Vorgehen sind Teil der unverbindlichen Beratung.
Eine Impulsberaterin oder einen Impulsberater in der Nähe finden Sie auf erneuerbarheizen.ch oder über den QR-Code unten:
Prüfen Sie mit dem Heizkostenrechner, wie viel Geld Sie mit einem Heizungsersatz sparen können: