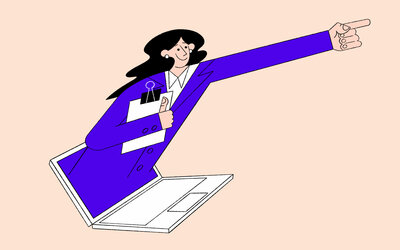Die Vorlage zur Abschaffung des Eigenmietwerts bringt auch steuerliche Änderungen für energetische Sanierungen mit sich. Der Wegfall des Bundessteuer-Abzugs kann durch gezielte Förderinstrumente kompensiert werden, während die kantonalen Abzugsmöglichkeiten bis 2050 zulässig bleiben. Das neue System ist systemkonform, fair und sozial ausgewogener als das bisherige und bleibt ökologisch nachhaltig.
Ja zur fairen Umsetzung der Eigenmietwert-Abschaffung
Am 28. September 2025 erhält das Schweizer Stimmvolk die historische Chance, eine über 100-jährige Ungerechtigkeit zu beenden – die Eigenmietwertbesteuerung. Der konkrete Abstimmungstext kann allerdings für Verwirrung sorgen, denn abgestimmt wird nicht ausdrücklich über die Abschaffung des Eigenmietwerts. Abgestimmt wird über eine Verfassungsänderung, die den Kantonen die Möglichkeit geben soll, eine Objektsteuer für selbstgenutzte Zweitliegenschaften einzuführen – als Option zur teilweisen Kompensation allfälliger Steuerausfälle. Im Hintergrund ist diese Vorlage an die Abschaffung des Eigenmietwerts gekoppelt. Wenn die Verfassungsänderung zur kantonalen Objektsteuer vom Stimmvolk und den Ständen angenommen wird, tritt das Bundesgesetz über den Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung und damit die Abschaffung des Eigenmietwerts für alle selbstgenutzten Liegenschaften automatisch in Kraft.
Neuregelung der Abzüge für energetische Sanierungen
Mit der Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung entfallen zukünftig auf Bundesebene die Abzüge für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen sowie für die Kosten für Rückbauten, und zwar bei sämtlichen Liegenschaften im Privateigentum. Die Kantone können diese Abzüge allerdings in eigener Kompetenz weiterhin zulassen. Das ist insofern ein wichtiger Faktor, als dass die kantonalen Steuern einen erheblich grösseren Anteil ausmachen und die Belastung für die Steuerpflichtigen hier wesentlich stärker ist.
Am Ende kaum Steuerausfälle
Die Bundesverwaltung geht beim heute geltenden Referenzzins von 1,5 Prozent statisch von Steuerausfällen von brutto rund 400 Mio. für den Bund und ca. 1 380 Mio. für Kantone und Gemeinden aus – wobei hier die aus meiner Sicht weiter gewünschten Abzüge für Umwelt und Klima 600 Mio. ausmachen. Wo die realen Zinsen die nächsten 10-30 Jahre liegen werden, weiss niemand, aber es ist kaum damit zu rechnen, dass das historisch tiefe Zinsniveau ewig dauert. Bei eher realistischen 2 Prozent betragen die Ausfälle statisch brutto nur noch knapp 200 Mio. beim Bund und 900 Mio. bei Kantonen und Gemeinden – nach Abzug der freiwilligen Abzüge für Energiemassnahmen auch nur noch knapp 300 Mio. für Kantone und Gemeinden. Wenn die Kantone noch die neu erlaubte Zweitwohnungsteuer einführen, bleiben mit knapp 100 Mio. schon statisch fast keine Steuerausfälle mehr.
Zudem: Die beim Bürger freiwerdenden Mittel dürften in Investitionen oder Konsum fliessen, was Wertschöpfung und Steuern generiert. Damit wird dynamisch mutmasslich klar mehr Steuersubstrat generiert, auch wenn die Zinsen nicht ansteigen. Damit wird die Vorlage am Ende auch aus finanzieller Sicht ein Gewinn: Die Menschen haben mehr Geld im Portemonnaie und Bund, Kantone und Gemeinden am Ende dynamisch eher mehr Steuereinnahmen.
Keine Angst vor Investitionsstopp
Mit der Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung entfallen zwar einige der bisherigen Abzugsmöglichkeiten bzw. werden beschränkt, eine solche Umsetzung ist aber systemkonform, fair und politisch breit abgestützt. Die Abschaffung der Eigenmietwertsteuer sorgt dafür, dass Wohneigentümer zukünftig von der ungerechten Zusatzbesteuerung für ein inexistentes Einkommen befreit werden, was wiederum zu mehr verfügbaren Geldmitteln führt. Zusammen mit den möglichen Subventionen von Bund und Kantonen sowie den kantonal möglichen Steuerabzügen ist nicht mit einer «Verlotterung» des Immobilienparks zu rechnen. Sowohl Unterhaltsarbeiten als auch energetische Sanierungen werden weiterhin stattfinden und Wertschöpfung und Steuern generieren. Immerhin geht es um das selbstgenutzte Eigenheim, das in der Regel einen grossen Vermögensbestandteil der Eigentümer ausmacht.
Verfassungsauftrag wird erfüllt
Obgleich die Bundesverfassung klar die Förderung des Wohneigentums statuiert, ist dieser Paragraf bislang eher toter Buchstabe geblieben. Statt gefördert, wird Wohneigentum in der Schweiz heute vielmehr durch diverse Steuern und Abgaben belastet. Zusammen mit dem hohen Preisniveau führt dies dazu, dass die Schweiz im europäischen Raum mit nur 36 Prozent Eigentumsquote das Schlusslicht bildet. Vor allem für jüngere Leute wird es immer schwieriger, aufgrund der Steuerbelastung, des Preisniveaus und der strengen Tragbarkeitsregeln den Traum der eigenen vier Wände realisieren zu können.
Die Vorlage erleichtert den Erwerb der eigenen vier Wände zum einen durch die Aufhebung der Eigenmietwertbesteuerung, wodurch die Steuerbelastung reduziert wird. Zum anderen beinhaltet die Vorlage einen «Sonder-Schuldzinsabzug» für Ersterwerber von selbstgenutztem Wohneigentum. Sie sollen künftig, gestaffelt über 10 Jahre nach dem Erwerb, von einem beschränken Abzug von privaten Schuldzinsen Gebrauch machen können. Dadurch wird die finanzielle Belastung in der Anfangsphase deutlich reduziert und zusammen mit der Abschaffung des fiktiven Eigenmietwerts, gerade für meist jüngere Ersterwerber, das selbstgenutzte Wohneigentum gefördert.
Der Inhalt der Abstimmungsvorlage kurz erklärt:
Mit einem Ja zur Einführung einer Objektsteuer auf Zweitliegenschaften entfällt künftig die Eigenmietwert-Steuer für selbstgenutztes Wohneigentum sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene. Gleichzeitig werden für diese Liegenschaften die Abzüge für die Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Versicherungsprämien sowie die Kosten der Verwaltung durch Dritte aufgehoben. Die vorgenannten Kosten stellen, solange der Eigenmietwert besteuert wird, sogenannte Gewinnungskosten dar, also Aufwendungen, die untrennbar mit der Erzielung des besteuerten Einkommens verbunden sind. Nach dem Systemwechsel mit dem Wegfall der Eigenmietwert-Steuer sind solche Aufwendungen deshalb nicht mehr abzugsfähig. Das ist konsequent, denn nur wenn ein Ertrag (Eigenmietwert) versteuert werden muss, sind die damit einhergehenden Gewinnungskosten abzugsberechtigt. Bei vermieteten Liegenschaften im Privatvermögen bleiben diese Abzüge folglich bestehen, denn die Mietzinseinnahmen müssen ja weiterhin versteuert werden.
Für alle Steuerpflichtigen eingeschränkt wird der Abzug von privaten Schuldzinsen. Künftig ist – je nach Vermögensverhältnissen – nur noch ein sogenannter quotal-restriktiver Abzug möglich. Kosten für denkmalpflegerische Arbeiten, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften, im Einvernehmen mit den Behörden oder auf behördliche Anordnung hin vorgenommen wurden, bleiben sowohl auf Bundes- als auch (fakultativ) auf Kantonsebene abzugsfähig.