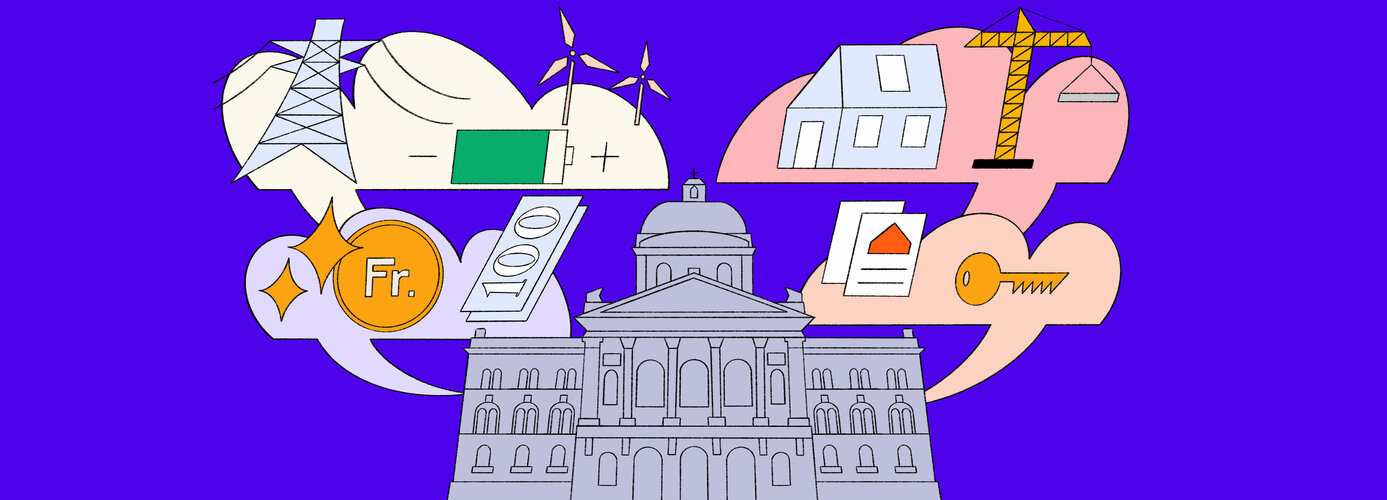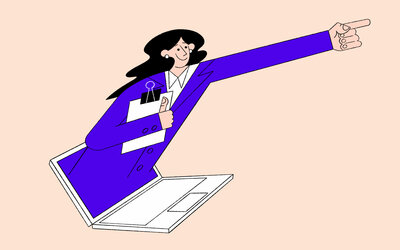Wohnraum ist in der Schweiz ein knappes Gut. Die Nachfrage steigt unaufhörlich – getrieben von Zuwanderung, Individualisierung und gesellschaftlichen Veränderungen. Doch statt diese Herausforderung entschlossen anzugehen, lähmt der Staat den Wohnungsbau.
Im Jahr 2010 dauerte es durchschnittlich 84 Tage, bis eine Baubewilligung erteilt wurde – heute sind es bereits 140 Tage. In Zürich sind es 170 Tage, in Basel 190 und in Genf sogar 500. Besonders absurd: Viele Verzögerungen entstehen nicht durch inhaltliche Prüfungen, sondern durch ineffiziente Verwaltungsprozesse. Baugesuche wandern von Schreibtisch zu Schreibtisch, statt koordiniert behandelt zu werden. Die Digitalisierung wird kaum genutzt. Während in anderen Ländern Baugesuche längst elektronisch eingereicht und in Echtzeit geprüft werden, verliert die Schweiz wertvolle Zeit mit Papierformularen und langwierigen Verfahren.
Hinzu kommen missbräuchliche Einsprachen, die selbst bewilligte Projekte auf Jahre hinaus blockieren können. Die sogenannte «fünfte Landessprache» – die Einsprache – wird längst gezielt eingesetzt, um Bauvorhaben zu blockieren. Jedes Jahr werden auf diese Weise mindestens 4000 Wohnungen verhindert.
Nun fordert Ständerat Hans Wicki (FDP, NW) mit einem Postulat, dass der Bundesrat endlich aufzeigt, wie die Bauverfahren verkürzt werden können. Die Verfahrensdauer von der Baueingabe bis zum Spatenstich soll auf maximal zwei Jahre gesenkt werden – ein längst überfälliger Schritt. Denn die Realität ist ernüchternd: Von der ersten Planung bis zur Fertigstellung eines Wohnprojekts vergehen oft Jahre – nicht etwa wegen mangelnder Baukapazitäten, sondern aufgrund einer überbordenden Bürokratie. Selbst der Bundesrat sieht den Handlungsbedarf und beantragt dem Parlament die Annahme des Postulates.
Die Behörden müssen ihre Prozesse beschleunigen und besser koordinieren, anstatt sie sequenziell abzuarbeiten. Ein Beispiel für eine effiziente Lösung ist das «Rote Telefon» des Amts für Baubewilligungen in Zürich, das auf Druck des HEV und des Gewerbeverbands eingeführt wurde. Hier können Unklarheiten bei bewilligten Projekten schnell, unbürokratisch und transparent geklärt werden – ein Modell, das schweizweit Schule machen sollte.
Gleichzeitig müssen Einsprachen auf schutzwürdige Interessen beschränkt werden. Ein Bauprojekt darf nicht jahrelang blockiert werden, nur weil es jemandem nicht gefällt, aus ideologischen Gründen abgelehnt wird oder das Quartierbild leicht verändern könnte. Missbräuchliche Einspracheverfahren sind ein massives Hindernis für die Schaffung von Wohnraum und müssen – im Sinne des Postulates «Einsprachen sind wieder auf schutzwürdige Interessen zu beschränken» von Andrea Caroni (FDP, AR) – dringend reduziert werden.
Die Postulate von Hans Wicki und Andrea Caroni setzen an der richtigen Stelle an. Doch Berichte allein lösen das Problem nicht – es braucht endlich griffige Massnahmen. Eine effizientere Verwaltung, kürzere Fristen und eine konsequente Digitalisierung sind der Schlüssel dazu. Die Wohnungsnot ist nicht gottgegeben – sie ist hausgemacht. Es liegt an der Politik, das zu ändern.
«Die Wohnungsnot ist nicht gottgegeben – sie ist hausgemacht. Es liegt an der Politik, das zu ändern.»