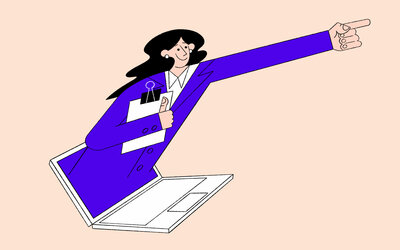Donnerstagnachmittag, in einer Gemeinde in der Agglomeration von Zürich: Ich sitze Frau Meier (Name von der Redaktion geändert) im Wohnzimmer ihrer Eigentumswohnung gegenüber, sie hat mich für ein Gespräch eingeladen. Und: Sie möchte anonym bleiben. Nicht, weil sie etwas zu verbergen hätte, sondern aus Angst vor Neid, vor Sachbeschädigungen, sogar vor Demonstrationen vor ihrer Wohnungstür. Dabei ist sie keine «Reiche», sondern hat ihr ganzes Leben verantwortungsvoll gearbeitet, selbst als Mutter stets in Teilzeit, was in dieser Generation keinesfalls selbstverständlich war. Ihr Ziel war immer, im Alter unabhängig und sicher zu sein.
Vor 15 Jahren kaufte sie sich eine Wohnung im Kanton Zürich – als Schutz vor dem Mietmarkt und unvorhersehbaren Schicksalsschlägen. Sie hatte Angst, dass ihr im hohen Alter die Wohnung gekündigt und sie möglicherweise aus ihrem persönlichen Umfeld gerissen werden könnte. Sie wollte Sicherheit und ein Dach über dem Kopf, das ihr niemand nehmen kann. Doch heute, im Ruhestand, wird genau dieses Zuhause für sie zur Last: Die Eigenmietwertbesteuerung und eine hohe Vermögenssteuer lasten schwer auf ihrem bescheidenen Einkommen. Das Eigenheim, das ihr eigentlich Sicherheit schenken sollte, wird stattdessen zur finanziellen Falle.
Eigenmietwert und Einkommen: Eine erschütternde Parität
Heute ist sie pensioniert. Ihre AHV-Rente beträgt 21 144 Franken, aus der Pensionskasse kommen bescheidene 6617 Franken dazu. Immerhin ist die obligatorische berufliche Vorsorge der 2. Säule seit 1985 verpflichtend in der Schweiz, sehr spät für Frau Meier, die Jahrgang 1939 hat und somit heute 86 Jahre alt ist. Ihr gesamtes Einkommen liegt bei gerade einmal 27 761 Franken im Jahr. Und doch soll sie einen Eigenmietwert von 27 600 Franken versteuern – fast genauso viel, als würde sie zusätzlich ein volles Jahresgehalt beziehen. Ein Einkommen, das sie nie sieht, das nur auf dem Papier existiert – aber auf das sie Steuern zahlen muss. In vielen Jahren kann sie nur den Pauschalabzug für Unterhalt geltend machen. Teure Sanierungen fielen bislang keine an, kleinere Arbeiten wie eine Küchenmodernisierung oder Bodenreparaturen reichen für weitergehende Abzüge nicht aus.
Eine Hypothek besteht nicht mehr. Frau Meier hat die Wohnung vollständig abbezahlt, da sie befürchtete, dass die Bank die Immobilie irgendwann neu bewerten und dadurch die Tragbarkeit der Finanzierung infrage stellen könnte. Aufgrund des geringen Einkommens hätte im schlimmsten Fall sogar ein Zwangsverkauf der Liegenschaft gedroht. Schuldzinsen kann sie also nicht mehr geltend machen. Die Konsequenz: Ein steuerbares Einkommen, das durch den fiktiven Eigenmietwert fast verdoppelt wird. Hinzu kommt die Vermögenssteuer. In Zahlen: Frau Meier zahlt aktuell 6034.05 Franken Steuern – ohne Eigenmietwert wären es nur rund 3105.75 Franken. Die Regelung führt zu einer faktischen Verdopplung der Steuerlast für eine Rentnerin mit minimalem Einkommen.
Steuerhölle Eigenheim?
Und die Lage spitzt sich zu: Im Kanton Zürich soll der Eigenmietwert im Durchschnitt um 10 Prozent, der amtliche Vermögenswert sogar um 50 Prozent steigen. Sollte das Stimmvolk am 28. September 2025 nicht «Ja» zur Objektsteuer – und damit zur Abschaffung des Eigenmietwertes – sagen, droht Frau Meier ab 2026 eine Steuerrechnung von rund 7700 Franken. Das ist für sie kaum noch tragbar.
Allein hätte sie ihre Wohnung auch kaum halten können. Ihre AHV- und Pensionskassenrente reichen bei weitem nicht aus, um die steigenden Steuerbelastungen durch den Eigenmietwert und die Vermögenssteuer zu tragen. Frau Meier hat nach schwierigen Jahren nochmals das Glück gehabt, eine neue Liebe zu finden. Ihr Partner erhält ebenfalls eine Rente, und gemeinsam können sie die finanziellen Lasten besser schultern. Trotzdem bleibt die Sorge, dass sich die Situation mit den angekündigten Erhöhungen weiter verschärft und sie auch in Zukunft kaum aufatmen können.
Falsch gespart?
«Ich habe mein Leben lang versucht, niemandem zur Last zu fallen», sagt sie mit belegter Stimme. Doch nun fühlt sie sich vom Staat bestraft. Wer eine Hypothek trägt, kann Schulden abziehen. Wer zur Miete wohnt, zahlt keine Eigenmietwertsteuer. Doch sie – die alles abbezahlt hat, die niemandem etwas schuldig ist und auch dem Staat nie zur Last fallen möchte – zahlt am meisten.
Sie spricht kaum darüber. Zu gross ist die Angst, als «reiche Besitzerin» abgestempelt zu werden. Dabei hat sie nichts gegen Umverteilung, nichts gegen Gerechtigkeit. Aber wo bleibt die Fairness für jene, die sich fürs Alter mit Disziplin und Verzicht absichern wollten?
Eigenverantwortliche Altersvorsorge entwertet
Die Eigenmietwertbesteuerung wurde einst als kurzfristige Steuer eingeführt, um die finanzielle Last des ersten Weltkriegs abzumildern. Heute wird die angebliche Gleichheit zwischen Eigentümern und Mietern als Begründung dieser Steuerlast herangezogen. Doch für Menschen wie sie – ältere Personen mit kleinem Einkommen – ist sie heute eine reale Bedrohung für die Existenz.
Immer mehr Pensionierte geraten unter Druck, erst recht aufgrund der anstehenden Erhöhungen der Eigenmietwerte und auch Vermögenswerte in verschiedenen Kantonen. Damit wächst die Steuerlast einmal mehr – das Einkommen aus AHV und Rente hingegen steigt nicht entsprechend an. Die Gefahr der Altersarmut trifft nicht nur jene, die nichts hatten – sondern auch jene, die ihr Leben lang mitgedacht haben.
Frau Meier steht exemplarisch für viele in der Schweiz. Menschen, deren grösster Wunsch es ist, ihren Lebensabend in Würde in den eigenen vier Wänden verbringen zu dürfen – ohne Angst vor Steuerrechnungen.