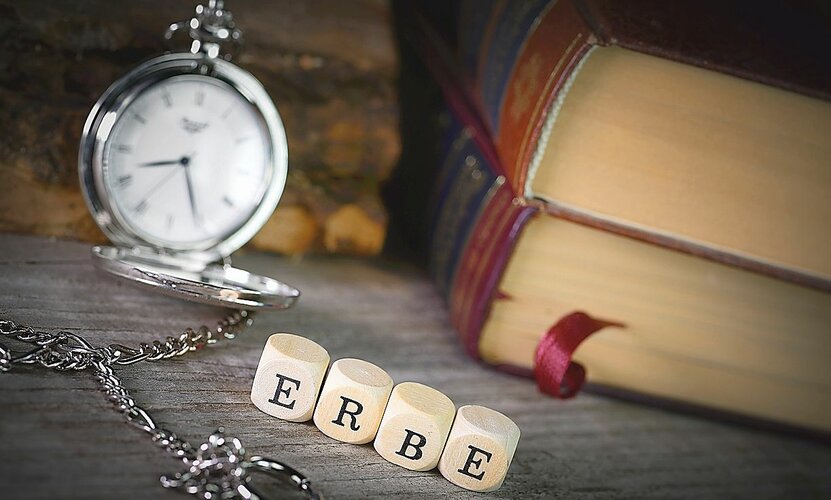Fast die Hälfte aller Eltern will ihren Kindern schon zu Lebzeiten einen Teil ihres Vermögens schenken – etwa, um ihnen den Kauf des Eigenheims zu erleichtern, für eine Ausbildung oder um die Gründung einer Firma zu ermöglichen. Das ist gut gemeint und kann sehr sinnvoll sein. Allerdings darf man dabei keine Fehler machen. Sonst kann es bei der Erbteilung Streit geben.
Ausgleichspflicht
Grundsätzlich gilt: Solange man lebt, darf man mit seinem Vermögen machen, was man will – es also auch verschenken. Kinder haben keinen Anspruch auf eine Zuwendung zu Lebzeiten und müssen nicht gleich behandelt werden. Allerdings gilt: Wer vorzeitig etwas bekommen hat, muss sich das grundsätzlich bei der Erbteilung an seinen Erbanteil anrechnen lassen. Diese Ausgleichspflicht sorgt für die Gleichbehandlung der Nachkommen.
Bekommt ein Kind mehr, als ihm zusteht, muss es die Differenz prinzipiell an die Miterben zurückzahlen. Das kann problematisch sein, wenn es sich um das Eigenheim handelt. Denn Immobilien gewinnen im Lauf der Jahre oft stark an Wert. Die Höhe der Ausgleichszahlung richtet sich jedoch nicht nach dem Wert beim Erbvorbezug, sondern nach dem Wert am Todestag. Die Folgen werden immer wieder unterschätzt.
So muss die Tochter, die im Beispiel in der Tabelle das Haus ihrer Mutter übernommen hat, dem Bruder nach dem Ableben der Mutter 425 000 Franken als Ausgleich zahlen. Der Grund: Seit sie das Haus der Mutter im Jahr 2006 als Erbvorbezug bekommen hat, ist der Wert des Hauses stark gestiegen. Diesen Mehrwert muss sich die Tochter an ihr Erbe anrechnen lassen – und kann für sie zum Problem werden: Ist das Geld im Eigenheim gebunden, fehlen ihr die Mittel für die Ausgleichszahlung.
Tipp: Halten Sie in Ihrem Testament oder Erbvertrag fest, wie der Erbvorbezug ausgeglichen werden soll. Solange Sie die Pflichtteile der übrigen Erben nicht verletzen, können Sie das beschenkte Kind ganz oder teilweise von der Ausgleichspflicht befreien.
Vermögensverzehr
Auch die Eltern können in finanzielle Bedrängnis geraten. Nach der Pensionierung müssen viele ihr Vermögen aufbrauchen, um den gewünschten Lebensstandard zu halten. Dafür kann das Geld fehlen, wenn sie zu früh zu viel weitergegeben haben. Erbvorbezüge und Schenkungen schmälern auch den Anspruch auf Ergänzungsleistungen, etwa wenn man pflegebedürftig wird.
Tipp: Oft ist es besser, Kinder mit einem Darlehen zu unterstützen. Wird es finanziell eng, kann man ein Darlehen zurückfordern. Und es gibt seltener Streit, weil sich die anderen Kinder nicht benachteiligt fühlen.
Steuerfolgen
Geben Eltern ihr Haus weiter und behalten das Wohn- oder Nutzniessungsrecht, kann das steuerliche Folgen haben. Oft übernimmt ein Kind die Hypothek oder andere finanzielle Verpflichtungen. Ist diese Gegenleistung zu hoch, kann der Fiskus dieses Geschäft als Verkauf bewerten – dann werden Grundstückgewinnsteuern und allenfalls Handänderungssteuern fällig.
So wird ein Erbvorbezug ausgeglichen
Beispiel: 2006 erhält die Tochter das Haus der Mutter als Erbvorbezug (Wert 700 000 Franken). Bei der Erbteilung ist das Haus viel mehr wert. | |||||
Übriges Vermögen der Mutter |
| Fr. 350'000 |
| ||
Heutiger Wert des Hauses |
| Fr. 1'200'000 |
| ||
Total Nachlass |
| Fr. 1'550'000 |
| ||
| 1/2 Tochter |
| Sohn 1/2 | ||
Erbteilung | Fr. 775'000 |
| Fr. 775'000 | ||
Ausgleich Haus | – Fr. 1'200'000 |
| – | ||
Erbausgleich | – Fr. 425'000 |
| + Fr. 425'000 | ||
Quelle VZ VermögensZentrum | |||||