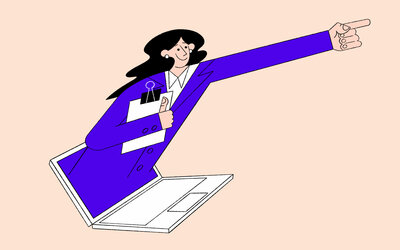«Just in time» steht für das Organisationsprinzip einer bedarfssynchronen Produktion. Das Konzept fasste vor rund fünf Jahrzehnten Fuss in grossen Produktionsbetrieben. Seine «Erfindung» wird dem Japaner Taiichi Ōno zugeschrieben, der es bei der Toyota Motor Company entwickelt und umgesetzt hatte. «Just in time» steht für die Produktions- und Lieferstrategie, in der das benötigte Material zum genauen Zeitpunkt und in jener Menge angeliefert wird, in der es in der Produktion benötigt wird. Zielsetzung ist eine Kosten- / Nutzenoptimierung in einem schlank aufgebauten Wertschöpfungsprozess – und damit die Erreichung einer wettbewerbsfähigen Marktposition. In den vergangenen Dekaden des wirtschaftlichen Aufschwungs hat sich das Prinzip weltweit verbreitet.
Jede Medaille hat aber bekanntlich zwei Seiten. Es ist kaum ein Zufall, dass «Just in time» ausgerechnet 1973, also just zur Zeit des weltweiten Ölschocks, durch seinen Einsatz beim japanischen Automobilhersteller Aufmerksamkeit erlangte. Treibende Kraft dafür war eine Rohstoff- und Materialmangellage, verbunden mit einem Preisschock. Unsere heutige Situation mit den Implikationen einer weltumspannenden Pandemie und eines Krieges auf unserem Kontinent ist Nährboden für eine ungleich grössere Krise. Immer mehr Lieferengpässe und Mangel-lagen sorgen für Produktionsausfälle und stark steigende Preise.
Gegenüber der Blütezeit von «Just in time» und auch des vielgepriesenen «Outsourcings», der Auslagerung von Fabrikationsteilschritten, sieht sich heute im Vorteil, wer über Materialvorräte und eine hohe eigene Fertigungstiefe verfügt. Das verringert die Abhängigkeit, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Kürzlich war von einem bekannten Schweizer Fabrikanten zu lesen, in dessen Produktion eine jahrzehntealte Maschine steht, die aber noch tadellos funktioniert. Den mit dieser Maschine intern durchgeführten Produktionsteilschritt wollte er einst aus Effizienzgründen auslagern. Heute ist er froh, dass sein Vater ihm als frischgebackenem Hochschulabgänger damals davon abgeraten hatte. Seine aktuelle Devise lautet denn auch: «Möglichst viel selbst machen».
Nicht alles, was früher war, ist per se schlecht. Vorratshaltung und mehr selbst zu machen dürften in verschiedensten Bereichen eine Renaissance erfahren.
«Nicht alles, was früher war, ist per se schlecht.»