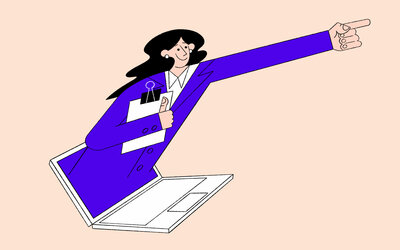Zwei Tage vor den jährlichen «Schnäppchen-Feiertagen» wie «Black Friday», «Black Weekend» und anderen mehr befasste sich der Bundesrat mit dem Thema der steigenden Wohnungsmieten. Dies vor dem Hintergrund des Hypothekarzins-Anstiegs, der — allerdings zeitlich stark verzögert — zur Erhöhung des für Wohnungsmieten relevanten Referenzzinssatzes führt. Dieser Satz war seit seiner Einführung 2008 laufend gesunken, von 3,5 auf 1,25 Prozent. Am vergangenen 1. Juni ist er erstmals wieder gestiegen, auf 1,5 Prozent. Mit weiteren Erhöhungen ist zu rechnen. Zusätzlich sind allgemeine Teuerungskosten sowie steigende Energiepreise und Gesundheitskosten zu tragen. Der Bundesrat hat deshalb beschlossen, die Mietzins-Entwicklung mit gezielten Massnahmen zu dämpfen. Im nächsten Sommer will er eine Änderung der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen in die Vernehmlassung geben, und parallel soll überprüft werden, ob das geltende Modell für Mietzinsanpassungen noch zeitgemäss ist. Die geplanten Dämpfungsmassnahmen beschränken und erschweren die Möglichkeit der Vermieter, die Mietzinse an gestiegene Kosten anzupassen. Komplizierte Vorgaben zu Nachweisen der Kostensteigerungen für Unterhalt und Betrieb der Liegenschaft sollen Vermieter davon abhalten, Anstiege auf die Mieten umzuwälzen. Und mit neuen Formularvorgaben bei Mietzinsanpassungen sollen die Mietparteien aktiv aufgefordert werden, Rendite oder Orts- und Quartierüblichkeit des Mietzinses überprüfen zu lassen. All dies führt in der Mietpraxis zu erheblichem Mehraufwand und damit zu neuen Zusatzkosten. Übrigens: Die Wohneigentümer bezahlen schon seit Längerem höhere Hypothekarzinsen. Und es kann kaum jemand abstreiten, dass sie von den weiteren Kostentreibern (Inflation, Energiekrise, Sanierungsvorschriften, Krankenkassenprämien) genau gleich betroffen sind wie die Mieter. Dazu ist aber nichts zu hören und nichts zu lesen.
Eingriffe ins Mietrecht helfen dem Wohnungsmarkt nicht. Die Aufmerksamkeit muss der Gewährleistung des nötigen Angebots gehören. Gefordert sind Anreize und Impulse für eine Entbürokratisierung und Intensivierung der Wohnbautätigkeit. Es braucht Ersatzbauten, die mittels Verdichtung in bestehenden Bauzonen eine effizientere Ausnutzung des Bodens bringen. Die Schweizer Wohnbaupolitik darf nicht länger mit ideologischen Vorgaben verhindert werden. Die Herausforderung ist klar: Das Angebot muss mit der Nachfrage im Einklang stehen. Kürzlich war von der Schweizer Justiz- und Polizeiministerin zu lesen, dass sie keine Angst vor der Zuwanderung und der 12-Millionen-Schweiz habe. Kein Zuwanderer bringt seinen Wohnraum mit …
«Eingriffe ins Mietrecht helfen dem Wohnungsmarkt nicht.»